Bei der Fassadengestaltung gilt es, immer die raumbildende Umgebung einzubeziehen. Checklisten helfen bei der Bestandsanalyse, der Formulierung des Gestaltungsziels sowie der Wahl der passenden Fassadenfarben und -materialien – zur Zufriedenheit des Kunden.
Im Prinzip ist die Gestaltung einer Fassade auch nichts anders als die Gestaltung eines Innenraumes. Während dort die vier Wände den Raum bilden, ist es bei den Fassaden der öffentliche Raum, die Umgebung, mit der jedes Bauwerk in Beziehung steht. So auch bei einem isoliert stehenden Gebäude: Hier bildet die umgebende Landschaft den räumlichen Bezug und gestalterischen Rahmen. Am deutlichsten wird das Zusammenspiel bei der Haus-an-Haus-Bebauung in einer Straßenzeile. Hier sind sowohl die benachbarten Häuser bei der Farbplanung zu berücksichtigen, als auch die gegenüberliegenden, denn der gesamte Straßenzug wird als Raum wahrgenommen. Diesen Raum sollten Sie als Gestalter berücksichtigen – dies sind Ihre Vorgaben.
I DIE BESTANDSANALYSE
Das A und O einer guten Farbplanung erfordert daher eine umfassende Bestandsaufnahme und -analyse. Neben der Farbigkeit der Umgebung sind bei dem zu gestaltenden Objekt vor allem die vorhandenen Stilformen und die Architektur des Gebäudes bei der Farbplanung zu berücksichtigen, denn grundsätzlich steht vor jeder Fassadengestaltung die Auseinandersetzung mit der Architektur. Bei der Farbwahl ist sowohl Know-how als auch Fingerspitzengefühl erforderlich. Wird eine Hausfassade zu sehr betont, sprengt sie das Gesamtbild und setzt sich zu sehr in den Vordergrund. Wenn es keine städtebaulichen oder denkmalpflegerischen Vorgaben wie zum Beispiel einen Farbleitplan gibt, können Sie sich auf Kundenwunsch hin auch für die Betonung des Gebäudes entscheiden.
Checklisten zum Gebäudeumfeld, der Gebäudearchitektur, der Kundenwünsche sowie aller vorhandenen Bauelemente an der zu gestaltenden Fassade helfen, die passenden Farbtöne und -materialien herauszuarbeiten.
Checkliste Gebäudeumfeld
– Wo steht das zu gestaltende Objekt, in ländlicher oder städtischer Umgebung, freistehend oder in eine Straßenzeile integriert?
– Welche Farben prägen die Umgebung?
– Wie sehen die Nachbargebäude aus und wie sind diese farblich gefasst?
– Gibt es bereits feststehende Materialien wie Klinkerflächen, Naturstein, Schindeln etc., die in das Farbkonzept zu integrieren sind?
Checkliste Gebäudearchitektur
– Wie ist der Stil des Gebäudes, wann wurde es erbaut?
– Sind historische Farbigkeiten einzubeziehen?
– Wie und von wem wird das Gebäude genutzt? Handelt es sich um ein Wohnhaus, Geschäftsgebäude, etc.?
– Wie sind die Gebäudeproportionen?
– Wie verhalten sich Öffnungen zu Wandflächen?
– In welcher Himmelsrichtung befindet sich die Fassade? Nordseiten verlangen eine andere Farbgebung als Südseiten.
– Wie ist die konstruktive Struktur des Gebäudes?
– Wie ist die Gliederung des Gebäudes: Gibt es Vor- und Rücksprünge, Balkonbrüstungen, Profile, Treppenhäuser?
– Wie ist das Dach ausgeformt, als Satteldach, Pultdach, Walmdach, Flachdach, Sheddach, Zeltdach?
– Weist das Gebäude markante Besonderheiten auf?
_ Sind vorgegebene Farbtöne und/oder Materialien vorhanden wie zum Beispiel Dach, Fensterrahmen, Klinker, Türen?
Checkliste der vorhandenen Bauelemente
Es lohnt sich, vor Beginn der Sanierung eine Checkliste zu erstellen, die alle Bauelemente der Fassade auflistet, sowohl der bleibenden, wie auch der neu zu gestaltenden Bereiche. Ein stimmiges Gesamtergebnis lässt sich nur entwickeln, wenn alle „Farbträger“ berücksichtigt werden.
Checkliste Untergrund
– Wie ist der vorhandene technische Aufbau: Handelt es sich um WDVS, Silkat oder Dispersion?
– Den technischen Aufbau der geplanten Materialien beachten, vor allem die Untergrundbehandlung!
– Beachten Sie die technischen Grenzen und nehmen Sie sie an.
– Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Fachberatung für die Befundung oder den Systemaufbau in Anspruch.
II DIE FARBKONZEPTION
Eine Analyse des Gebäudes bildet die Grundlage für die Entwicklung eines Farbenkonzepts. Dabei bietet es sich an, wie folgt vorzugehen:
Gestaltungsziel formulieren
1. Betonung oder Anpassung: Soll sich das Gebäude harmonisch in seine Umgebung einfügen und Bezug auf sie nehmen, oder planen Sie, das Gebäude aufgrund Ihrer analytischen Feststellungen eigenständig erscheinen zu lassen? Oder soll das Gebäude herausgestellt werden, weil es eine werbewirksame Fassade ist?
2. Anmutung: Soll das Gebäude elegant, kühl, warm, sachlich, freundlich, einladend, modern, traditionell, innovativ, frisch, zeitlos, etc. wirken?
3. Architektur: Soll die vorhandene Architektur unterstrichen und herausgearbeitet werden? Oder gibt es Bereiche, die architektonisch ungünstig sind und die Sie mit Ihrer Gestaltung korrigieren möchten? Soll die Erbauungszeit farblich berücksichtigt werden? Ist es ein Denkmal?
4. Akzentuierung: Gibt es Bauelemente oder Bereiche, die Sie betonen möchten? Möchten Sie Schwerpunkte setzen, Orientierung geben etc.?
5. Materialien: Planen Sie vorgegebene Farbtöne und Materialien ein.
6. Inhalt: Soll die Gebäudekubatur/Oberfläche das Innere nach Außen widerspiegeln (form follows function)?
7. Kundenwunsch: Planen Sie die Wünsche und Vorgaben des Kunden ein – die beste Gestaltung wird in der Schublade enden, wenn Sie nicht mit den Vorstellungen und Vorlieben des Kunden übereinstimmt!
III GESTALTUNGSTIPPS
Auf der Grundlage der Bestandsanalyse und nachdem das Gestaltungsziel formuliert wurde, geht es darum, ein Farbkonzept für die Fassade mit einem Farbenklang zu erstellen. Wichtig ist dabei, die proportionalen Verhältnisse einzelner Farbflächen zueinander zu beachten. Wird die intensivste Farbe in großen Mengen eingesetzt, werden andere Farben „überpowert“, unterdrückt. Eine starke Farbe in kleinerer Menge wirkt als Akzent und belebt die schwächer gesättigten Farben. Weitere Tipps:
Benutze die dominanteste Farbe in der geringsten Menge.
Wie intensiv wirkt eine Farbe? Ein kleines Farbmuster kann uns bezüglich der Sättigung eines Tones leicht täuschen.Am besten arbeiten Sie mit mögichst großen Musterflächen. Wenn Zweifel bestehen und Sie sicher gehen möchten, ist eher eine vergrautere Tönung zu empfehlen.
Je größer die Fläche, desto heller erscheint die Farbe
Sie können im Außenbereich dunkler vorgehen, als es die kleinen Farbmuster suggerieren. Für den Außenbereich gilt: Je größer die Fläche, desto heller erscheint die Farbe
Je grober die Struktur, desto dunkler erscheint ein Farbton.
Eine glatte Fläche reflektiert die auffallenden Lichtstrahlen gleichförmig (Einfallswinkel =Ausfallswinkel). Eine strukturierte Fläche streut das Licht. Das heißt, das Licht wird in unterschiedliche Richtungen zurückgeworfen, Teile der Lichtstrahlen gehen an unserem Auge vorbei. Gleichzeitig erzeugen die Erhebungen in einer groben Untergrundstruktur Schatten, was ebenfalls zur optischen Verdunkelung eines Farbtones beiträgt. Also wirkt der gleiche Farbton auf glattem Untergrund heller als auf strukturiertem Untergrund.
Machen Sie den Test! Vergleichen Sie einen Farbton aus dem Farbtonblock mit einem größeren Muster aus der Box! Und nun stellen Sie sich den Vergleich mit diesem Muster und einer Fassade vor!
Beachten Sie die Hellbezugswerte
Gestaltung: Aneinander angrenzende Farbtöne eines Farbbereichs sollten in der Gestaltung eine Differenz von 20 im Hellbezugswert nicht unterschreiten. Ansonsten ist der Unterschied nicht deutlich zu erkennen und die Töne verschwimmen ineinander.
Technik: Bei Farbbeschichtungen auf WDVS ist zu beachten, dass der Hellbezugswert (HBZ) in der Regel nicht unter 20 liegen soll – die Beschichtung würde sich bei Farbtönen
Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Telefon: +49 (6154) 71-0
Telefax: +49 (6154) 71-1391
http://www.caparol.de/Weiterführende Links
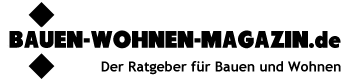

Comments are closed.